Forschung
Forschungsfelder und aktuelle Forschungsprojekte am Lehrstuhl Kirchengeschichte II
Forschungsfelder und aktuelle Forschungsprojekte am Lehrstuhl Kirchengeschichte II
Die Kirchengeschichte als theologische Disziplin hat die Geschichte des Christentums und der Kirchen zu ihrem Gegenstand. In Forschung und Lehre umfasst die Arbeit am Lehrstuhl für Kirchengeschichte II den Zeitraum vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Drei Schwerpunkte sind hier besonders ausgeprägt: (1) Martin Luther und die Reformation, (2) die Aufklärung und (3) die Kirchliche Zeitgeschichte.

© Annette Zoepf
Der erste Schwerpunkt befasst sich mit dem Vorabend der Reformation, mit Person, Werk und Theologie Martin Luthers sowie mit der Reformationsgeschichte und dem beginnenden Konfessionellen Zeitalter. Neben den frühneuzeitlichen Druck- und Bildmedien werden u.a. Theorie und Praxis reformatorischer Gottesdienste und Predigten erforscht. Das Lutherjahrbuch als das führende Organ der internationalen Lutherforschung wird vom Lehrstuhlinhaber jährlich herausgegeben.
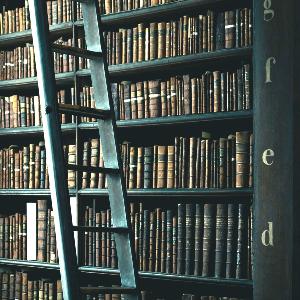
Der zweite Schwerpunkt fokussiert die Zeit der Aufklärung und fragt nach den unterschiedlichen Ausformungen und Akteuren in Theologie und Kirche. Von der Frühaufklärung und der sogenannten Übergangstheologie bis hin zur Neologie als der reifen Gestalt der theologischen Aufklärung reicht das Spektrum. Zeitschriften und Kirchenbibliotheken stellen besondere Forschungsinteressen dar.

© Nora Schulze
Der dritte Schwerpunkt gilt der Kirchlichen Zeitgeschichte mit den spezifischen Themenfeldern Kirche und Theologie in der Zeit des Nationalsozialismus, christlicher Widerstand im Nationalsozialismus, kirchliche Erinnerungskultur nach 1945, Diskriminierung von Christen in der DDR sowie der Zusammenhang von Protestantismus, Staat und Gesellschaft 1945 bis 1990 in Ost- und Westdeutschland. Die enge Vernetzung des Lehrstuhls mit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte gibt der Kirchlichen Zeitgeschichtsforschung ein zusätzliches Gewicht und bietet ideale Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit.

© Roland Lehmann
Unter Leitung von Prof. Dr. Christopher Spehr untersucht ein interdisziplinäres Team die Unterdrückungsmechanismen und Repressionsmaßnahmen des SED-Staates in den 1960er Jahren am Beispiel der Bausoldaten, Totalverweigerer und Jugendlichen im Widerstand gegen die Wehrerziehung mit Schwerpunkt Thüringer Raum.
Der Projektabschluss des von 2020 bis 2023 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena angesiedelten und vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft geförderten Vorhabens erfolgt nebenberuflich. Neben dem 2023 erschienen Tagungsband werden 2025 Band 2 über Totalverweigerer, 2026 Band 3 über Bausoldaten und 2027 Band 4 über Schülerinnen und Schüler im Widerstand gegen die Wehrerziehung in der Reihe "Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte" veröffentlicht.
Nach seiner Arbeit als Wissenschaftlicher Koordinator des Forschungsteams im Drittmittelprojekt wirkt PD Dr. Roland M. Lehmann seit Sommersemester 2024 als Lehrstuhlvertretung für Prof. Thomas Kaufmann am Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen.
Theologische Fakultät
Platz der Göttinger Sieben 2
D-37073 Göttingen
Roland.Lehmann@theologie.uni-goettingen.de
Tel: 0551-39-27455
Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Anita Henneberger untersucht Schülerinnen und Schüler im Widerstand gegen die Wehrerziehung in den 1960er in Thüringen. Sie arbeitet derzeit als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen in der Geschäftsstelle des Landesfrauenrates Thüringen.
anita.henneberger@landesfrauenrat-thueringen.de
Mobil: 0172 1672703
Der Historiker Marius Stachowski untersucht die ersten Jahrgänge der Bausoldaten und ist seit 2023 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchen- und Theologiegeschichte an der Universität Siegen (Prof.in Dr. Veronika Albrecht-Birkner).
marius.stachowski@uni-siegen.de
Tel.: +49 (0) 271-740 2007
Der evangelische Theologe Maximilian Rosin ist seit Oktober 2023 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte II der LMU München. Er untersucht die Verfolgung von Wehrdiensttotalverweigerern in den 1960er Jahren als Beispiel für die Diskriminierung von Christen in der DDR.
Gerhard Gloege (1901–1970) war einer der bedeutendsten deutschen evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts, der in Jena sowie Bonn als Professor für Systematische Theologie lehrte. Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren unter anderem die Auseinandersetzung mit den Deutschen Christen in Mitteldeutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der Widerstand gegen die sog. Entbürgerlichung der Universitäten im Sozialismus sowie die ökumenische Vernetzung des internationalen Luthertums. Die Untersuchung erfolgt in vier Zugängen: Zunächst wird sein Wirken in exemplarischen Konfliktfeldern betrachtet (biographische Perspektive), danach sein kirchliches Wirken erarbeitet (kirchenpolitische Perspektive), daraufhin seine Tätigkeit als Professor für Systematische Theologie in Jena vertieft (fakultätsgeschichtliche Perspektive) und eine orientierende Darstellung seines theologischen Werkes vorgenommen (theologiegeschichtliche Perspektive). Somit will die Dissertation zeitgeschichtliche Grundlagenforschung leisten, indem durch die Arbeit mit dem Nachlass, Briefwechseln und weiteren Quellen zu Gerhard Gloege Akteure und Netzwerke der bisher nicht im Zentrum der Forschung stehenden frühen DDR untersucht werden.
Pfr. i.R. Gabriel-Alexander Reschke erläutert sein Dissertationsprojekt in einem zeitzeichen-Artikel aus dem Jahr 2020.
Die 1924 gegründete, 1941 kriegsbedingt eingestellte und am Osterfest 1946 wieder erscheinende Thüringer Kirchenzeitung „Glaube und Heimat“ steht im Mittelpunkt des Dissertationsprojekts zur kirchlichen Pressearbeit in der DDR. Einerseits sollen die entstehungs- und entwicklungsgeschichtlichen Aspekte der Thüringer Kirchenzeitung und ihrer Artikel in der Auseinandersetzung mit der staatlich normierten Öffentlichkeit und zensierten Medienlandschaft im Zeitraum von 1946 bis 1989 erschlossen werden. Darüber hinaus ist es das Ziel, exemplarisch anhand von „Glaube und Heimat“ die Bedeutung und Funktion dieses Publikationserzeugnisses für unterschiedliche Teilbereiche kirchlichen Handelns und Selbstverständnisses im genannten Zeitraum zu untersuchen.
Kristin Sommerschuh absolviert derzeit ihr Vikariat der EVLKS in Leipzig.